12. Agathe-Lasch-Preis
Der Germanist Dr. Jeffrey Pheiff wurde
am 10. Juni 2025
mit dem Hamburger Förderpreis
für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
auf dem Gebiet der niederdeutschen Sprachforschung
– dem Agathe-Lasch-Preis –
ausgezeichnet.
•
Erste Germanistik-Professorin Deutschlands: Agathe Lasch
WDR Zeitzeichen – Der Geschichtspodcast. 04.07.2024. 14:58 Min. Verfügbar bis 05.07.2099. WDR 5: HIER.
"Die am 04.07.1879 geborene Lasch setzt sich für eine freie Wissenschaft ein – gegen alle Hindernisse, die ihr als Frau und Jüdin im frühen 20. Jahrhundert begegnen."
Wichtigste Interviewpartnerinnen: Christine M. Kaiser (Publizistin) und Ingrid Schröder (Professorin)
•
Agathe-Lasch-Gastwissenschaftlerinnenprogramm
Aktuell
forscht die Althistorikerin Kerstin Droß-Krüpe in Hamburg zu
gewalttätigen Frauen im römisch beherrschten
Ägypten.
Mehr Informationen darüber gibt es HIER.
•
1. Juni 2023
Christine
M. Kaiser: „Auch ich bin […] dem Niederdeutschen nicht ganz treu
geblieben“. Genese und zeitgenössische Rezeption der
berlinischen Sprachgeschichte Agathe Laschs – ein
Werkstattbericht
Vortrag im Rahmen der 135. Jahresversammlung des
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
vom
29.05.–01.06.2023 in Greifswald
•
11. Agathe-Lasch-Preis
Die Germanistin Dr. Hannah Rieger wurde
am 22. März 2023
mit dem Hamburger Förderpreis
für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
auf dem Gebiet der niederdeutschen Sprachforschung
– dem Agathe-Lasch-Preis –
ausgezeichnet.
Pressemitteilung
•
Das 100-jährige Wörterbuch
Zum
100-jährigen Bestehen der Universität Hamburg wurde ein Video
– auch – über Agathe Lasch erstellt.
Es kann HIER angeschaut werden.
•
Gefunden:
Auf POLITIK
100x100, dem Blog des Fachgebiets Politikwissenschaft an der
Universität Hamburg, stellt David Weiß seit dem 26. Juni
2019
Agathe Lasch vor. Interessant: Die Abbildung des Schreibens der
"Landesunterrichtsbehörde, Hochschulwesen" vom 4. April 1934 an
die Universität Hamburg, in dem diese davon unterrichtet wird,
dass u.a. Agathe Lasch "mit Ablauf des 30. Juni 1934 auf Grund § 6
des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in den
Ruhestand versetzt" wird.
Beitrag
•
10. Agathe-Lasch-Preis
Die Sprachwissenschaftlerin Dr. Marie-Luis Merten wurde
am 10. Dezember 2019
mit dem Hamburger Förderpreis
für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
auf dem Gebiet der niederdeutschen Sprachforschung
– dem Agathe-Lasch-Preis –
ausgezeichnet.
Pressemitteilung
•
September 2019:
Christine
M. Kaiser: "... bitte, fassen Sie dies rein sachlich auf." Die
Thematisierung wissenschaftlicher Kontroversen in den Briefen der
Germanistin Agathe Lasch (1879–1942). In: Renata Dampc-Jarosz, Pawel Zarychta (Hrsg.): "...
nur Frauen können Briefe schreiben". Facetten weiblicher
Briefkultur nach 1750. Band 2. Frankfurt am Main: Peter Lang 2019, S. 241–254 [Perspektiven der Literatur- und Kulturwissenschaft. Transdisziplinäre
Studien zur Germanistik. Hrsg. von Renata Dampc-Jarosz, Zbigniew
Feliszewski, VOL. 4].
•
4. Juli 1879 – 4. Juli 2019
Am 4. Juli 2019
jährt sich der Geburtstag Agathe Laschs zum 140. Mal. Um darauf
aufmerksam zu machen, wird seit dem 31. März dieses Jahres
täglich ein Zitat aus ihren Schriften getwittert, und zwar
HIER
•
Einen Versuch war's wert:
20. März 2019 – Brief an die Senatskanzlei der Stadt Berlin:
Sehr geehrter Herr,
hiermit bitte ich den Senat der Stadt Berlin um Einrichtung einer
Ehrengrabstätte für die von den Nationalsozialisten ermordete
erste Germanistikprofessorin Deutschlands, Prof. Dr. Agathe Lasch
(geboren am 4. Juli 1879 in Berlin –
gewaltsam zu Tode gekommen am 18. August 1942 in den Wäldern um
Riga, zuletzt wohnhaft Berlin-Schmargendorf,
Caspar-Theiß-Straße 26), die sich durch seinerzeit viel
beachtete und auch heute noch für die Stadtsprachenforschung
grundlegende Publikationen um das Berlinische verdient gemacht hat.
Weitere Informationen zu ihrem Hauptwerk finden sich zum Beispiel hier:
www.agathe-lasch.de/buch4.htm
Das Grab der Eltern und des Bruders Agathe Laschs befindet sich auf dem
Jüdischen Friedhof Weißensee. Ihre Schwestern – Hedwig Kauffmann sowie Elsbeth und Margarete Lasch –
wurden gleich ihr Opfer der Shoah. Der Grabstein des Ehemanns und Sohns
der ältesten Schwester Hedwig befindet sich direkt neben dem Grab
der Familie Lasch.
Für die sich durch ihre wissenschaftlichen Forschungen um Berlin
verdient gemachte Germanistin Agathe Lasch gibt es indes kein Grab in
ihrer Heimatstadt. Ihre Gebeine befinden sich wie die der übrigen
937 ermordeten Insassen des 18. Osttransports in den Massengräbern
um Riga. Überlebt hatte das Massaker lediglich die
vierundzwanzigjährige Erna Cussel aus Berlin-Mitte.
Es wäre meines Erachtens eine schöne und vor allem auch
angemessene Geste, wenn die Stadt für Agathe Lasch eine
Grabstätte einrichten würde und damit das Verdienst Agathe
Laschs um Berlin würdigte. Ob die Familiengrabstätte durch
einen entsprechenden Zusatz erweitert werden könnte, vermag ich
nicht zu sagen, da sich der gesamte Friedhof unter Denkmalschutz
befindet.
Über die Bestätigung meiner Eingabe auf diesem Wege wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Mit freundlichen Grüßen
Die ANTWORT kam noch am selben Tag:
Mir wurde bedauernd mitgeteilt, dass "im Falle von Frau Prof. Dr.
Agathe Lasch keine Anerkennung einer Ehrengrabstätte möglich"
sei. Und zwar aufgrund "der für das Verwaltungshandeln
verbindlichen Regelung in den Ausführungsvorschriften zu § 12
Abs. 6 Friedhofsgesetz", wonach "nur tatsächlich bestehende
Grabstätten von verstorbenen Persönlichkeiten als
Ehrengrabstätten des Landes Berlin anerkannt werden" können.
Unter Verweis auf die von mir "dargestellten historischen Gründen"
bestehe aber eine "solche Grabstelle leider nicht in Berlin".
•
Zum Weltfrauentag am 8. März 2019:
Anna Priebe: Die Erste – Agathe Lasch im Porträt.
In: 19neunzehn. Hochschulmagazin der Universität Hamburg.
HIER
•
25. April 2019
Prof. Dr. Ingrid Schröder (Niederdeutsche Sprache und Literatur)
spricht im Rahmen der Ringvorlesung "GEISTES-gegenwärtig"
an der Universität Hamburg zum Thema:
"das Wort in das Leben einstellen" – Agathe Lasch, die erste Germanistik-Professorin in Hamburg.
Ort: Universität Hamburg, Überseering 35, Hörsaal G
Zeit: 16:15 –17:45 Uhr
Info: HIER
•
Wiederentdeckt:
Im Nachlass der letzten
Agathe-Lasch-Schülerin, der Germanistin Martta Jaatinen,
fanden sich weitere sechs Postkarten, die die Finnin von der zuletzt in
Berlin lebenden Niederdeutschforscherin erhalten hatte. Sie
stammen aus der Zeit zwischen dem 24. Juni 1938 und dem 1. Juni 1942.
Aus ihnen geht hervor, wie unermüdlich Lasch ihrer Schülerin
fachlich beistand und sie motivierte, ihre Dissertation
zielstrebig zu Ende zu schreiben. Ein letzter Brief, den Jaatinen 1943
an ihre Lehrerin nach Berlin schrieb, ohne zu wissen, dass diese schon
im August 1942 von den Nazis deportiert und ermordet worden war, kam
unzustellbar an sie zurück.
•
Agathe Lasch am Puls der Zeit
"In der
"Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft" vom 3. August wird
von einer französischen wissenschaftlichen Gesellschaft berichtet,
die 'ein Museum der Dialekte' zu errichten gedenkt. Da ist es
vielleicht angebracht, einmal über die Fachkreise hinauszugehen
und einen größeren Leserkreis daran zu erinnern, welche
Pflege die deutschen Mundarten in den letzten Jahrzehnten gerade bei
uns finden. Wenn ich dabei die hamburgischen Verhältnisse mehrfach
etwas heraushebe, so wird man das verständlich finden. [...]"
So beginnt
ein kürzlich wiederentdeckter Artikel, den Agathe Lasch gerade
einmal drei Tage nach Lektüre des Berichtes über die geplante
Einrichtung eines "Museums der Dialekte" unter dem Titel
"Mundart-Forschung in Deutschland" am 6. August 1925 auf Seite 23 des
Hamburgischen Correspondenten publizierte.
•
"LU har återlämnat delar av
tyskt bibliotek"
Interview mit dem
Bibliothekar Per Stobaeus (UB Lund) zur Restitution der Bücher
Agathe Laschs im "Lunds Universitets Magasin": HIER
•
"Lunds universitet återlämnar böcker till rättmätiga arvtagare"
Nachdem - wie weiter unten berichtet - nachgewiesen
werden konnte, dass ein kleiner
Teil der 1942 von der Gestapo geraubten Privatbibliothek Agathe
Laschs 1951 auf Betreiben des Rechtshistorikers Guido Kisch von der
Jewish Cultural Reconstruction, Inc. (JCR) dem "deutschen Seminar" an
der Universität Lund "als Gabe" übersandt und in die
Bibliothek des Seminars eingeordnet worden war, sind dort inzwischen
elf Bücher als aus Laschs Bibliothek stammend identifiziert
worden. Die Universitätsbibliothek Lund und die Bibliothek
des Sprach- und Literaturzentrums Lund haben nun angekündigt, diese elf Bücher an die in Deutschland anerkannten
Rechtsnachfolger zu restituieren. HIER
In
dem Konvolut befindet sich unter anderem ein Agathe Lasch gewidmetes Exemplar der Dissertation
von Hertha Isaacsen zum Thema "Der junge Herder und Shakespeare".
Isaacsen war 1930 an der Hansischen Universität bei Agathe Laschs
Kollegen Robert Petsch promoviert worden. Zehn Jahre später wurde
ihr der Doktortitel auf Beschluss der Universität vom 3.5.1940 aus
fadenscheinigen Gründen aberkannt - sie sei "z.Z. unbekannten
Aufenthalts". Tatsächlich war die Jüdin Hertha
Isaacsen emigriert. Vgl. Wolfgang Beck und Johannes
Krogoll: Literaturwissenschaft
im "Dritten Reich". Das Literaturwissenschaftliche Seminar zwischen
1933 und 1945. – In: Hochschulalltag im Dritten Reich. Die
Hamburger Universität 1933–1945. Hrsg. von Eckart Krause.
Bd. 2. Hamburg 1992, S. 705–735, hier: S. 720.
Die Publikation über die näheren Umstände der Entdeckung in Lund wird voraussichtlich 2018 erscheinen.
•
Agathe Lasch vermittelte der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 1921 eine bedeutende Schenkung:
"*Schenkung
für die Staats- und Universitätsbibliothek. Amerikanischen
Freunden verdankt die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
eine wesentliche Förderung. Während des Krieges stellte
Professor Dr. Karl Detlev Jessen von Bryn Mawr in Pennsylvanien an
amerikanischen, namentlich deutsch-amerikanischen Zeitschriften und
Zeitungen, Büchern, Broschüren, Plakaten, Aufrufen und
Kleindrucken zusammen, was ihm persönlich oder durch die Gunst
seiner Beziehungen erreichbar war. So kam eine schöne Sammlung von
reichhaltigen, zum Teil fast vollständigen Beständen
amerikanischer Zeitungen in deutscher und englischer Sprache sowie eine
Fülle von Einzelnummern von Organen aus den verschiedenen
Bereichen der Union in verschiedenen Sprachen zusammen. Schöne
Bestände an Broschüren und buchmäßigen
Veröfffentlichungen amerikanischen Ursprungs werden zusammen mit
ähnlichen Beständen gleichen Inhalts, die der Bibliothek von
anderer Seite zugeflossen sind, ihr eine ähnliche bedeutsame
Stellung unter den großen deutschen Büchersammlungen
für das Auslandsdrucktum des Weltkrieges sichern wie sie sie jetzt
dank ihres Besitzes an Flugschriften aus der Zeit des 80jährigen
Krieges gegenüber anderen Instituten im Deutschen Reich auf diesem
Sondergebiet einnimmt.
Professor Jessen starb plötzlich am 25.
September 1919. Es war ihm nicht vergönnt gewesen, nähere
Bestimmungen über seine Sammlung zu treffen, die er nach
Kriegsende einer deutschen Bibliothek überweisen wollte. Seine
Witwe, Frau Myra S. Jessen, verfügte über die Fülle von
Drucken im Geiste ihres Gatten, und durch Vermittlung von Frl. Dr.
Lasch kam sie an unsere Staats- und Universitätsbibliothek.
Die
Herren Ferdinand Thun, Gustav Oberländer und Henry Janssen, die
Inhaber der 'Berkshire Knitting Mills', gaben die sehr
beträchtlichen Mittel her, um die Schenkung, die 50 Kisten
faßte, nach Deutschland befördern zu lassen.
In seiner
Sammlung wird jetzt unsere Bibliothek vor den Toren seiner alten
deutschen Heimat – Professor Jessen stammte aus Winnemark bei
Eckernförde – sein Andenken festhalten." In: Neue Hamburger
Zeitung Nr. 141 (Morgen-Ausgabe) vom 25.3.1921, S. 2.
•
5. März 2017
Christine
M. Kaiser: "... bitte fassen Sie dies rein sachlich auf." – Die
Thematisierung wissenschaftlicher Kontroversen in den Briefen der
Germanistin Agathe Lasch (1879–1942).
Vortrag im Rahmen der internationalen wissenschaftlichen
Tagung
"... nur Frauen können Briefe schreiben"
Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750
vom 3.–5.3.2017 an der Universität Krakau
Programm
•
Ankündigung:
Angeregt
durch einen Hinweis in Elisabeth Gallas' Monographie "Das Leichenhaus
der Bücher." Kulturrestitution und jüdisches Geschichtsdenken
nach 1945. Göttingen/Bristol: Vandenhoeck & Ruprecht 2013, S.
147f. konnte zwischenzeitlich nachgewiesen werden, dass ein kleiner
Teil der 1942 von der Gestapo geraubten Privatbibliothek Agathe
Laschs 1951 auf Betreiben des Rechtshistorikers Guido Kisch von der
Jewish Cultural Reconstruction, Inc. (JCR) dem "deutschen Seminar" an
der Universität Lund "als Gabe" übersandt und in die
Bibliothek des Seminars eingeordnet wurde. Eine Publikation über
die näheren Umstände dieser Entdeckung ist in
Vorbereitung.
•
Soeben erschienen:
Doris
Wagner: Die wissenschaftliche Beziehung zwischen der Hamburger
Germanistin Agathe Lasch (1879–1942) und dem finnischen
Germanisten Emil Öhmann (1894–1984): Eine Spurensuche. In:
Mari Tarvas, Heiko F. Marten, Antje Johanning-Radziene (Hg.):
Triangulum. Germanistisches Jahrbuch 2015 für Estland, Lettland
und Litauen. Folge 21: Beiträge des 10. Nordisch-Baltischen
Germanistentreffens, Tallinn, 10.–13.6.2015, S. 527–535. PDF
•
9. Agathe-Lasch-Preis
Die Sprachwissenschaftlerin Dr. Viola Wilcken wurde
am 14. Februar 2017
mit dem Hamburger Förderpreis
für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
auf dem Gebiet der niederdeutschen Sprachforschung
– dem Agathe-Lasch-Preis –
ausgezeichnet.
Pressemitteilung
•
Soeben erschienen:
Christine
M. Kaiser: "Ihnen aber statte ich wenigstens schriftlichen Dank ab
...". Agathe Lasch, Thomas Mann und die "Neuordnung der
Rechtschreibung" 1920/21. Ein Werkstattbericht. In: Auskunft.
Zeitschrift für Bibliothek, Archiv und Information in
Norddeutschland, 36 (2016) Hf. 2, S. 261–284.
Christine
M. Kaiser: "Wenn sich doch endlich einmal ein Hoffnungsstrahl bieten
würde!" Agathe Laschs vergebliches Warten auf den Ruf nach
Dorpat/Tartu. In: Nd. Jb. 139 (2016), S. 87–102.
•
22. Oktober 2016
Christine
M. Kaiser: "Schwer schon war es, sich den Weg zur Universität zu
bahnen." Agathe Lasch (1879–1942) – die erste
Germanistikprofessorin Deutschlands an der Hamburger Universität.
Vortrag im Rahmen der "Internationalen wissenschaftlichen
Konferenz
Die Frau – Wissen, Wissenschaft, Universitäten
Europa und die Welt"
vom 21.–23.10.2016 an der Universität Warschau
•
Schon 2014 erschienen:
Jolanta Łada-Zielke: Przerwana profesura Agathe Lasch. In: Midrasz. Pismo Żydowskie. Nr. 1 (2014), S. 66–68.
•
NEU – im Januar 2016:
Ingrid
Schröder: Agathe Lasch und die niederdeutsche Philologie. In:
Alastair G.H. Walker (Hrsg.): Classics Revisited. Wegbereiter der
Linguistik neu gelesen. Frankfurt am Main: Peter Lang 2016, S.
61–79 [Kieler Forschungen zur Sprachwissenschaft, Bd. 6].
•
• • • EILMELDUNG – 17. Januar 2016 • • •
In den von der Zweigbibliothek Germanistik
der Humboldt-Universität zu Berlin
aus einem Berliner Antiquariat zurückgekauften
21 Kisten mit Büchern, die seit 2011 ausgesondert worden waren,
wurden weitere sechs Bücher aus der 1942 von der Gestapo geraubten
Privatbibliothek Agathe Laschs entdeckt
(vgl. die Eilmeldung vom 19. März 2015 weiter unten).
Es handelt sich dabei um folgende Bücher, die nachweislich
aus dem Kontingent der 175 Titel stammen, die im Januar 1943
im Zugangsbuch des Germanischen Seminars an der Universität Berlin,
versehen mit dem Vermerk „aus der Bibliothek A. Lasch“,
inventarisiert worden waren (vgl. Kobold/Harbeck 2007, S. 20ff.).
Vorangestellt ist auch hier jeweils die Nummer aus dem alten Inventarbuch,
ebenso ist der Titel demselben entnommen
(vgl. Kobold/Harbeck 2007, S. 50ff.):
• 29356 – Neckel, G[ustav]: Beiträge zur Eddaforschung. [Mit Exkursen zur Heldensage], Dortmund 1908.
• 29358 – Gisla Saga Súrssonar, hrsg. von Finnur Jónsson, Halle 1903.
• 29359 – Brennu-Njálssaga (Njála), hrsg. von Finnur Jónsson, Halle 1908.
• 29360 – Friõthjófs saga ins frœkna, hrsg. von L[udvig] Larsson, Halle 1901.
• 29361 – Gunnlaugs saga ormstungu, hrsg. von E[ugen] Mogk, Halle 1886
• 29361 – Eyrbyggja saga, hrsg. von H[ugo] Gering, Halle 1986.
Des Weiteren wurde – zufällig – im
Freihandbestand der Zweigbibliothek Germanistik
der folgende Titel aus der Privatbibliothek Agathe Laschs gefunden:
• 29492 – Tunnicius, die älteste niederdeutsche Sprichwörtersammlung, hrsg. von H. von Fallersleben, Berlin 1870.
•
Im DARL
(Digitales Archiv zum Rostocker Liederbuch)
ist als Volldigitalisat online zur Verfügung gestellt:
Agathe Lasch: Mittelniederdeutsche Grammatik.
Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer 1914
HIER
•
27. Mai 2015
Christine
M. Kaiser: "Wenn sich doch endlich einmal ein Hoffnungsstrahl bieten
würde!" Agathe Laschs vergebliches Warten auf den Ruf nach
Dorpat/Tartu.
Vortrag im Rahmen der 128. Jahresversammlung des
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
vom
25.–28.05.2015 in Tallinn (Estland)
•
• • • EILMELDUNG – 19. März 2015 • • •
In einem Berliner Antiquariat wurden
von Mitarbeitern der Arbeitsstelle Grimm-Briefwechsel
am Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin
die folgenden vier Titel
aus der 1942 von der Gestapo geraubten
Privatbibliothek Agathe Laschs entdeckt.
Die streckenweise stark annotierten Bücher stammen nachweislich
aus dem Kontingent von 175 Titeln, die im Januar 1943
im Zugangsbuch des Germanischen Seminars an der Universität Berlin,
versehen mit dem Vermerk „aus der Bibliothek A. Lasch“,
inventarisiert worden waren (vgl. Kobold/Harbeck 2007, S. 20ff.).
Im Rahmen eines Provenienzforschungsprojekts waren 2007
60 der 175 Titel in den Beständen der UB der Humboldt-Universität
gefunden und daraufhin restituiert worden,
während die übrigen 115 Bände seinerzeit nicht auffindbar waren.
Zusammen mit weiteren wertvollen historischen Beständen
wurde seit 2011 offensichtlich ein Teil dieser Bücher
als „Dubletten“ aus der Zweigbibliothek
der Germanistik an der Humboldt-Universität ausgesondert,
als Meterware an das Antiquariat veräußert
und von diesem weiterverkauft,
einiges vielleicht sogar als Makulatur vernichtet.
Die folgenden vier Titel konnten zwischenzeitlich
durch Initiative
der Grimm-Sozietät zu Berlin e. V., gegr. 1991,
aus dem Antiquariat zurückgeholt werden.
Vorangestellt ist jeweils die Nummer aus dem alten Inventarbuch,
ebenso ist der Titel demselben entnommen
(vgl. Kobold/Harbeck 2007, S. 50ff.):
•
29355 – Die Lieder der älteren Edda (Saemundar Edda) hrsg.
von K[arl] Hildebrand, 2. Aufl. von H[ugo] Gering, Paderborn 1904.
•
29455 – E[berhard]G[ottlieb] Graff: Deutsche Interlinearversionen
der Psalmen aus dem 12. u. 13. Jh., Quedlinburg und Leipzig 1839.
•
29484 – Die Fabeln des Erasmus Alberus, hrsg. von W[ilhelm]
Braune, Halle 1892 (Haller Neudrucke Nr. 104–107).
•
29496 – Pietsch, P[aul]: Ewangely und Epistel Teutsch, die
gedruckten hochdeutschen Perikopenbücher (Plenarien)
1473–1523, Göttingen 1927.
In Kürze wird hier eine Liste mit allen Büchern
aus Agathe Laschs Privatbibliothek veröffentlicht,
die nach 1945 an verschiedenen Orten wiederentdeckt wurden.
•
Weltfrauentag am 8. März 2015 auf NDR.de
AGATHE LASCH – eine von "Hamburgs starken Frauen"
•
NEU – im Dezember 2014:
Christine
M. Kaiser, Doris Wagner: "Leider kann ich Ihnen keine Gegengabe
schicken, die aus meiner Feder stammt." Zwei Briefe der Hamburger
Germanistin Agathe Lasch (1879–1942) an den finnischen
Germanisten Emil Öhmann (1894–1984). In: Jahrbuch des
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 137 (2014), S.
105–121.
•
Agathe-Lasch-Preis 2013
Der Sprachwissenschaftler Dr. Tom Smits wurde
am 9. Dezember 2013
mit dem Hamburger Förderpreis
für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
auf dem Gebiet der niederdeutschen Sprachforschung
– dem Agathe-Lasch-Preis –
ausgezeichnet.
Pressemitteilung
Rede anlässlich der Verleihung des Preises
•
Agathe Lasch
Historisches Porträt im Magazin der Heidelberger Alumni
Mirjam
Mohr: Eine Soziolinguistin der ersten Stunde. Agathe Lasch war die
erste Germanistik-Professorin Deutschlands. In: HAIlife. Heidelberg
Alumni International. Magazin 2013, S. 18/19.
•
NEU – im August 2013:
Christine
M. Kaiser: Agathe Lasch. In: SZENE HAMBURG GESCHICHTE. Hamburg: Vom
Dorf an der Alster zur Elbmetropole. Ausgabe 5. Hamburg: Hamburger
Stadtillustrierten Verlagsgesellschaft mbH 2013, S. 93.
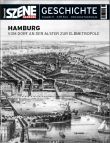
•
Agathe-Lasch-Coachingprogramm
An
der Universität Hamburg hat die Stabsstelle Gleichstellung in
Kooperation mit dem Career Center ein Coaching-Programm für
Juniorprofessorinnen und Habilitandinnen ins Leben gerufen, für
das Agathe Lasch als Namensgeberin fungiert. Bericht über die Auftaktveranstaltung am 30. Januar 2013
•
Datenbank zu Berliner Stolpersteinen
Die
"Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin" präsentiert auf einer
Website die Daten der in Berlin verlegten Gedenksteine sowie
Biographien einzelner Opfer. Dazu gehören auch die Daten der
Stolpersteine für Agathe Lasch und ihren beiden Schwestern Elsbeth
und Margarete. HIER klicken
•
NEU – im Dezember 2012:
Reimer
Hansen: Agathe Laschs Leben und Werk im Spiegel neuerer
Veröffentlichungen. Dieter Hertz-Eichenrode zum 80. Geburtstag.
In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands.
Zeitschrift für vergleichende und preußische
Landesgeschichte. Im Auftrag der Historischen Kommission zu Berlin
herausgegeben von Klaus Neitmann, Wolfgang Neugebauer und Uwe Schaper.
58 (2012) 1, S. 153–174. Beitrag bei de Gruyter.com online
•
"NS-Raubgut in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin"
Im
Rahmen der systematischen Überprüfung von
Bibliotheksbeständen der Zentral- und Landesbibliothek Berlin nach
"NS-verfolgungsbedingt entzogenem Raubgut" wurden auch Bücher
entdeckt, die aus der Privatbibliothek Agathe Laschs stammen. Informationen über die Bücher Agathe Laschs
•
Christine
M. Kaiser, Mirko Nottscheid: Agathe Lasch (1879–1942) und die
Hamburger Germanistik: Vertreibung – gescheiterte Emigration
– lokale Disziplinengeschichte. In: Inge Hansen-Schaberg, Hiltrud
Häntzschel (Hrsg.): Alma Maters Töchter im Exil. Zur
Vertreibung von Wissenschaftlerinnen in der NS-Zeit. München:
edition text + kritik 2011 [Frauen und Exil, 4].

Verlagsinfo
•
Matthias
Harbeck: Bücher jüdischer Provenienz und
Restitutionsbemühungen an der Universitätsbibliothek der
Humboldt-Universität zu Berlin: Die Bibliothek Agathe Laschs /
Books of Jewish provenance and efforts of restitution at the University
Library of Humboldt-University in Berlin: The library of Agathe Lasch /
Les livres de provenance juive et les efforts de restitution à
la bibliothèque universitaire de l'Université Humboldt de
Berlin: la bibliothèque d'Agathe Lasch. In: BIBLIOTHEK Forschung und Praxis. 34 (2010) H. 1, S. 60–63.
•
Wieder erhältlich – auch als eBook:
Reprint der "Mittelniederdeutschen Grammatik"
aus dem Verlag Max Niemeyer, Tübingen
Agathe Lasch: Mittelniederdeutsche
Grammatik. 2. unveränderte Auflage von 1974. Reprint. Berlin / New
York: DE GRUYTER 2011. Verlagsinfo und Bestellung
•
Ingrid
Schröder: "... den sprachlichen Beobachtungen geschichtliche
Darstellung geben" – die Germanistikprofessorin Agathe Lasch. In:
Rainer Nicolaysen (Hrsg.): Das Hauptgebäude der Universität
Hamburg als Gedächtnisort. Mit sieben Porträts in der NS-Zeit
vertriebener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hamburg: Hamburg
University Press 2011, S. 81–111. Verlagsinfo mit Link zum frei verfügbaren Volltext
•
Am
11. Mai 2010
wurden in der
Caspar-Theiß-Straße 26
im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf
in Erinnerung an die Schwestern
Elsbeth, Agathe und Margarete Lasch,
die hier bis zu Ihrer Deportation am 15. August 1942 lebten,
drei Stolpersteine verlegt.
Fotos *
* Leider wurde in den Stolperstein für Margarete Lasch ein unrichtiges Geburtsjahr eingraviert: Korrekt ist 1880.
•
Agathe-Lasch-Preis 2010
Der Philologe Dr. Wilfried Zilz wurde
am 28. Januar 2011
mit dem Hamburger Förderpreis
für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
auf dem Gebiet der niederdeutschen Sprachforschung
– dem Agathe-Lasch-Preis –
ausgezeichnet.
Pressemitteilung
•
Christine
M. Kaiser: "... ausnahmsweise eine weibliche Kraft". Agathe Lasch
– die erste Germanistikprofessorin Deutschlands am Germanischen
Seminar der Hamburger Universität. In: Mirko Nottscheid, Myriam
Richter (Hg.): 100 Jahre Germanistik in Hamburg. Traditionen und
Perspektiven. Berlin, Hamburg: Dietrich Reimer Verlag 2010 [Hamburger
Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte, Band 19].

Verlagsinfo
•
4. Juli 2010 – 14 bis 17 Uhr
Garten der Frauen
auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg
Einweihung des Erinnerungssteins für
Prof. Dr. Agathe Lasch
im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des
9. Geburtstages des Gartens der Frauen
Info: Einladung
•
22. April 2010 – 10.30 Uhr
Hauptgebäude der Universität,
Edmund-Siemers-Allee 1
Feierliche
Verlegung von zehn „Stolpersteinen“ auf dem
Bürgersteig vor dem Hauptgebäude der Universität Hamburg
– in Erinnerung an ehemalige Mitglieder der Universität, die
in den Jahren 1933 bis 1945 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft oder
ihrer politischen Aktivitäten Opfer des Nationalsozialismus
wurden. Einer der zehn Stolpersteine erinnert an die erste Professorin an der Hamburgischen Universität, Agathe Lasch.
•
Mirko
Nottscheid, Christine M. Kaiser, Andreas Stuhlmann (Hg.): Die
Germanistin AGATHE LASCH (1879–1942). Aufsätze zu Leben,
Werk und Wirkung. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2009. [Auskunft.
Zeitschrift für Bibliothek, Archiv und Information in
Norddeutschland, 29 (2009) 1/2 + Bibliothemata. Hrsg. von Hermann
Kühn, Michael Mahn, Johannes Marbach, Harald Weigel, Else Maria
Wischermann, Bd. 22].
 
Darin:
•
Christine M. Kaiser: Zwischen "Hoffen" und "Verzagen". Die
Emigrationsbemühungen Agathe Laschs. Ein Werkstattbericht. –
S. 11–46.
• Ingrid Schröder: Agathe Lasch und die Hamburger Lexikographie. – S. 47–62.
•
Andreas Stuhlmann: "Sprache ist Geschichte; Sprache bedeutet
Geschichte". Agathe Lasch als Rezensentin. – S. 63–88.
•
Matthias Harbeck, Sonja Kobold: Die Rekonstruktion einer
Forscherbibliothek. Reste der Privatbibliothek Agathe Laschs an der
Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin.
– S. 89–108.
•
Mirko Nottscheid: Die Germanistin und Niederlandistin Annemarie
Hübner (1908–1996). Zur wissenschaftlichen Biografie einer
Hamburger Sprachforscherin zwischen Weimarer Republik und
Nachwendezeit. Mit unveröffentlichten Briefen von Agathe Lasch.
– S. 109–168.
•
Moritz Terfloth: "Wer oder was ist bzw. war 'Lasch'?" Zur Benennung des
Agathe-Lasch-Wegs in Hamburg. – S. 169–188.
• Dieter Möhn: Der Agathe Lasch-Preis. Memorial und Verpflichtung. – S. 189–203.
•
Brit Bromberg: Agathe Laschs Korrespondenz in der Arbeitsstelle
Hamburgisches Wörterbucharchiv (1917–1934). Ein Verzeichnis.
– S. 205–242.
•
Christine
M. Kaiser: "Ich habe Deutschland immer geliebt ..." Agathe Lasch
(1879–1942) – Deutschlands erste Germanistikprofessorin an
der Hamburgischen Universität. – In: Joist Grolle, Matthias
Schmoock (Hg.): Spätes Gedenken. Ein Geschichtsverein erinnert
sich seiner ausgeschlossenen jüdischen Mitglieder. Bremen: Edition
Temmen 2009 [Hamburgische Lebensbilder in Darstellungen und
Selbstzeugnissen, hrsg. vom Verein für Hamburgische Geschichte,
Bd. 21].

Informationen und Bestellung
•
Sonja Kobold, Matthias Harbeck: "Aus der
Bibliothek Agathe Lasch" – Provenienzforschung an der
Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin.
Berlin 2008 [Schriftenreihe der Universitätsbibliothek der
Humboldt-Universität zu Berlin; 63].

•
Matthias Harbeck, Sonja Kobold:
Spurensicherung – Provenienzforschung zur Bibliothek von Agathe
Lasch. Ein Projekt an der Universitätsbibliothek der
Humboldt-Universität zu Berlin. – In: Stefan Alker,
Christina Köstner, Markus Stumpf (Hg.): Bibliotheken in der
NS-Zeit. Provenienzforschung und Bibliotheksgeschichte. Göttingen,
Wien: Vienna University Press bei V&R unipress 2008, S.
89–102. – Verlagsinformation
•
Christine M. Kaiser: Agathe Lasch (1879–1942). Erste Germanistikprofessorin Deutschlands. Teetz, Berlin: Hentrich & Hentrich 2007. 95 Seiten, 14 Abbildungen. 7,80 € * – Rezension

Bestellen per E-Mail
oder
per Bestellformular
* innerhalb Deutschlands versandkostenfrei
|